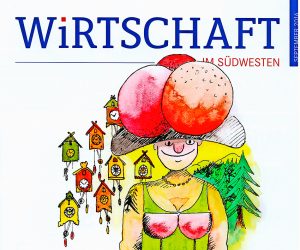Seit 1973 geben die IHKs Hochrhein-Bodensee, Schwarzwald-Baar-Heuberg und Südlicher Oberrhein die Wirtschaft im Südwesten zusammen heraus. Eine lange Zeit, in der nicht nur in der Welt viel passiert ist. Auch der Südwesten hat eine rasante Entwicklung hinter sich – und, wenn alles gut läuft, wohl eine noch größere vor sich. Claudius Marx, Thomas Albiez und Dieter Salomon, Hauptgeschäftsführer der drei IHKs im Regierungsbezirk Freiburg im Gespräch über die Vergangenheit und die Zukunft der Region.

Wenn Sie auf die Entwicklung des Südwestens seit 1973 zurückblicken, machen Sie da irgendwelche Meilensteine in der Geschichte aus?
Claudius Marx: Ich könnte keine disruptiven Ereignisse benennen, nichts, was die Zeiten in vorher und nachher teilt. Die Region hat sich kontinuierlich weiterentwickelt – und das ganz außerordentlich. Im Zeitraffer und aus der Vogelperspektive gesehen, würde man staunen, was da alles an Wirtschaft, an Gewerbegebieten, Verkehrsinfrastruktur und Siedlungsdichte entstanden ist.
Thomas Albiez: Für mich ist in der Rückschau beeindruckend, wie die Region den permanenten Strukturwandel, die Krisen und Umbrüche bewältigt hat. Als hier oben bei uns die Uhren- und die Unterhaltungsindustrie ihre Tore dicht machten… Kienzle, Dual, Saba. Jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlug, las man von einer neuen Insolvenz, die tausende Arbeitsplätze kostete. Damals galt das hier als Armenhaus Baden-Württembergs und die Arbeitslosigkeit schnellte in die Höhe…
Marx: Bei uns am Hochrhein war es analog dazu die riesige Textilindustrie, von der heutzutage nur noch einige wenige Spezialanbieter zeugen.
Albiez: Wenn man bedenkt, was das alles für Verwüstungen angerichtet hat und was daraus dann hier entstanden ist. Das grenzt an ein Wunder.

Wie konnte das gelingen?
Albiez: Ich denke, es sind die mittelständischen, eigentümergeführten Strukturen mit all ihren Eigenschaften, die uns stark machen. Fleiß, Beständigkeit, Sparsamkeit und auch Bescheidenheit. Und jetzt steht die Herausforderung „Transformation“ auf der Türschwelle, die es zu meistern gilt.
Dieter Salomon: Diese Stärken machen dann aber auch Hoffnung für die aktuellen und die kommenden Krisen.
Albiez: So argumentieren wir immer. Dass uns nicht bange sein muss. Wir kriegen das hin. Aber die Politik muss den Menschen und den Unternehmen auch Rückenwind geben und sie nicht noch zusätzlich behindern.
Woran liegt es, dass der politische Rückenwind so oft ausbleibt?
Salomon: Weil wir es aktuell mit Krisen ohne Schmerzen zu tun haben. Die Massenentlassungen früherer Zeiten – so schlimm sie waren – waren immer aber auch sichtbare Signale an die Politik, dass Handlungsbedarf besteht. Momentan entsteht dagegen das verwirrende Bild von einer Wirtschaft, in der die Rezession abgesagt ist und sogar ein ganz leichtes Plus erwartet wird. Also alles nicht so schlimm?
Dabei gibt es gleichzeitig Branchen – zum Beispiel die energieintensiven von Chemie, Stahl bis Zement – denen es aufgrund ihrer Konzernstruktur vielleicht global okay geht, die aber wegen der Rahmenbedingungen hier nicht mehr in den hiesigen Standort investieren und ihn mittelfristig aufgeben werden. Das ist ein schleichender Verlust – der vom Arbeitskräftemangel noch befeuert wird.
Eine Krise bewältigen und Chancen nutzen, kannst du nur, wenn du das entsprechende Personal dafür hast. Das ist zurzeit nicht der Fall.
Trotzdem gehen die Alarmglocken in der Politik nicht an, weil man noch den alten Reflexen folgt: Krise = Arbeitslosigkeit = „Wir müssen was tun“. Bedeutet umgekehrt: Keine Arbeitslosigkeit = keine Krise = „Alles nicht so schlimm“. Das ist ein gefährlicher Trugschluss. Wir laufen Gefahr, Unternehmen zu verlieren.
Das Tempo bei all diesen Veränderungen hat deutlich zugelegt. Muss einem das Angst machen?
Marx: Die Beschleunigung gilt ja nicht nur für die Krisen, sondern auch für die Chancen. Alle neuen Technologien schaffen auch neue Möglichkeiten.
Ich denke, im Wesentlichen ist nicht die Beschleunigung das Problem, sondern die Lücke zwischen der Wirtschaft, die sich der Beschleunigung stellt, und anderen Strukturen, die da nicht mithalten und auf ihrem Tempo beharren: Der politische Prozess wird nicht schneller, der administrative Prozess bemüht sich – dennoch wird der Gap größer. Das ist ein Thema, dem sich eine Gesellschaft als Ganzes stellen muss.
Sind in Sachen Veränderungsfülle und -tempo die nächsten 20 Jahre vergleichbar mit den letzten 50?
Marx: Wenn das mal reicht. Wir arbeiten zurzeit alle noch an den Folgen der Digitalisierung – und die Künstliche Intelligenz steht schon vor der Tür. Wie eine Welle, die über die vorangegangene hinwegrollt.
Welche Rolle wird in diesem globalen digitalen Prozess die Region noch spielen?
Albiez: Im Zuge der Globalisierung und der Digitalisierung war immer vorhergesagt worden, dass das Konzept der Region bedeutungslos werden würde. Interessanterweise ist das Gegenteil eingetreten. Der Mensch als soziales Wesen braucht wohl doch einen Anker, der ihm Halt gilt, um die Dynamik zu bewältigen. Die Region gewinnt an Bedeutung. Zumal mit Blick auf die gestörten Lieferketten.
Nach wie vor ist es in Baden-Württemberg so, dass man in einem Radius von 50 bis 80 Kilometern alles bekommen kann, was man für seinen Wertschöpfungsprozess benötigt.
Diese enorme Dichte an Mittelstand ist das, was den Unterschied macht – und mehr erreicht, als was durch die Summe der einzelnen Betriebe möglich wäre. Der Wissenspool und die Skaleneffekte sind die Werkzeuge, mit denen sich der Wandel erfolgreich wird meistern lassen.

Apropos Globalisierung und Lieferketten – wie müssen wir in Zukunft damit umgehen?
Salomon: Das ist tatsächlich knifflig. Die Coronapandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben uns ein weiteres Mal gezeigt, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen sollte – wobei wir gerade Gefahr laufen, das beim Energiethema wieder zu tun.
Andererseits können wir uns bei aller Lieferkettenproblematik aus der globalen Arbeitsteilung nicht zurückziehen. Wir brauchen sie – und auch die Länder auf der anderen Seite der Welt. Durch die Globalisierung sind Hunderte von Millionen Menschen weltweit der Armut entkommen. Das kann man nicht zurückdrehen.
Die Herausforderung wird sein, Alternativen zu etablieren, die Globalisierung ein Stück weit rückgängig zu machen, ohne auf sie zu verzichten – mit dem Ziel, unsere Unternehmen resilienter zu machen gegen Krisen.
Die Globalisierung genießt – besonders in den Augen der jungen Generation – kein gutes Image…
Marx: Und doch ist sie Garant unserer Gegenwart und unserer Zukunft.
Inwiefern?
Marx: Wenn wir an die letzten 50 Jahre zurückdenken, haben wir es nicht nur mit einem großen Strukturwandel zu tun, sondern auch mit einem gigantischen Wohlstandszuwachs. Und der kam nicht etwa dadurch zustande, dass wir fleißiger waren als unsere Eltern und die wiederum als ihre Eltern. Er ist das Ergebnis eines enormen Zuwachses an Produktivität – generiert durch ein immer ausgefeilteres System von Arbeitsteilung, Globalisierung und Lieferketten. Unsere Produktivität entscheidet darüber, wie wir jetzt und in Zukunft leben.
Der Preis für dieses System ist seine Komplexität und seine Verletzlichkeit…
Marx: In der Tat. Wir gehen auf sehr dünnem Eis. Kleine Störungen können mittlerweile eine Krise rund um den Globus auslösen. Die Schweiz musste jüngst ihre Bankenkrise binnen weniger Stunden lösen, bevor die Börsen in den USA öffnen.
Wir werden deshalb in Zukunft mehr Zeit und Energie darauf verwenden müssen, unsere Systeme widerstandsfähiger zu machen. Präventiv, um im weltweiten Wettbewerb unsere Produktivität halten oder noch ausbauen zu können. Schließlich werden wir uns die heute gerne geforderte Work-Life-Balance und, ganz aktuell, die Vier-Tage-Woche nur mit einem entsprechenden Mehr an Produktivität leisten können.
Salomon: Wohlstand wird in der öffentlichen und politischen Meinung als selbstverständlich vorausgesetzt. Es geht nicht mehr darum, wo kommt der her. Eine schwierige Haltung.
Albiez: Das sehe ich auch so. Und ich weiß nicht, wie lange wir diesen Spagat noch hinbekommen. Das System, in dem wir leben, ist ausgerichtet auf materiellen Wohlstand. Aber das System, dem gerade Jugendliche aktuell anhängen, basiert auf einem ganz anderen Wertesystem, das zwar vorgibt, nichts mit materiellen Werten zu tun zu haben – aber doch auf ihm aufsetzt. Ich denke, irgendwann muss sich die Politik in der Zielvielfalt, die sie in ihrer Wirtschaftspolitik hat, für eine wesentliche Variable entscheiden.
Diese Ambivalenz belastet unsere Mittelständler sehr, das hören wir in unseren Gesprächen immer wieder.
Zurzeit wird in der öffentlichen Meinung tatsächlich viel in Frage gestellt. Wie gehen Unternehmer damit um?
Albiez: Es zwingt sie, die mediale Welt teilweise auszublenden, um nicht komplett die Lust am Unternehmertum zu verlieren. Das ist auch der Unterschied zu früheren Krisen. Wenn man sich immer rechtfertigen muss, ist es umso schwerer, zu sagen „Los, das packen wir“.
Diese schleichende Resignation oder das Ausweichen auf Alternativen anderswo ist gefährlich. Die (Ersatz-)Investitionsquoten hierzulande sind schon seit Jahren zu niedrig, um weiteres Wachstum zu gewährleisten.
Marx: Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn schon der Begriff des Wachstums negativ konnotiert ist. Wer hier investiert, um Wachstum zu generieren, muss sich dafür erklären.
Wobei, die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge zu erklären, war auch in den vergangenen 20 Jahren immer ein Herausforderung. An dem Thema sind wir als IHKs ja schon lange dran.

Was im Zuge der aktuellen Klimadiskussion nicht einfacher wird…
Marx: Ja, stimmt. Es ist schwer zu kommunizieren, dass das Problem beim Klima tatsächlich nicht die Wirtschaft ist, sondern unsere Lebensweise. Die Wirtschaft ist Teil der Lösung.
Wenn wir die halbe Strecke gehen, indem wir als Gesellschaft unser Mindset verändern, und die andere halbe Strecke durch Technologie lösen, haben wir eine richtig gute Chance, die Kurve zu kriegen.
Immerhin gibt es zwei positive Botschaften: Mit Sonne, Wind, Wasser und Geothermie gibt es auf dieser Welt Energie im Überfluss. Und wir verfügen über die technologischen Fähigkeiten, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir es „nur“ noch tun.
Ein Rückblick auf 50 Jahre im Südwesten wäre nicht vollständig, ohne einen Blick auf die nachbarschaftlichen Beziehungen. Wie steht es um unser Verhältnis zu Frankreich und der Schweiz?
Salomon: Auch wenn immer wieder Hürden auftauchen, ist das deutsch-französische Verhältnis weiterhin ein gutes. Angesichts der aktuellen Krisen denke ich, dass beide Länder gut daran täten, offensiver gemeinsam zu führen. Das würde der EU wahrscheinlich guttun.
Im Rückblick kann man sagen, dass die Grenzregion in den vergangenen 50 Jahren einen immensen europäischen Schub bekommen hat. Damals gab es noch Grenzen und verschiedene Währungen, heute haben wir – trotz aller Schwierigkeiten – einen funktionierenden Binnenmarkt. Ein unglaubliches Erfolgsmodell.
Marx: Das deutsch-schweizerische Verhältnis ist schon immer komplex. Aber auch trotz des erstmal gescheiterten Rahmenabkommens ist die gemeinsame Geschichte nicht zu Ende. Das wird weiterverhandelt… Dazu sind wir einfach schon viel zu sehr verflochten. Und dass es schon mal Reibungen gibt, zeugt doch nur davon, dass wir so viel miteinander zu tun haben. Wäre das nicht so, gäbe es keine Reibereien.
Albiez: Man darf auch nicht vergessen, dass die Schweiz und Frankreich extrem wichtige Handelspartner für die Region sind. Man denkt immer an China, aber das stimmt gar nicht. Schweiz und Frankreich führen die Liste an.
Ich denke, in unserem Dreiländereck steckt noch viel mehr Potenzial. Know-how, etwa von Seiten der Hochschulen, das dem hiesigen Mittelstand das Bewältigen der Herausforderungen erleichtern würde. Aber man muss die Bedingungen dafür schaffen, dass das grenzüberschreitend funktionieren kann und gefördert wird.
Ich verweise da gerne auf unser eng und vertrauensvoll zusammenarbeitendes Medizintechnikcluster in Tuttlingen.
Marx: In den nächsten Dekaden werden wir – noch stärker als in der Vergangenheit – alle Infrastrukturprojekte grenzüberschreitend denken müssen. Von Straßen über Mobilfunk bis zum Wasserstoff – wenn wir es uns weiter leisten, dass all diese Netze Richtung Grenze auslaufen, bekommen wir die weißen Flecke nie geschlossen. Nur wenn das alles transnational gedacht wird, wird sich die Region gut entwickeln. Am Ende steht und fällt mit den Netzen die Entwicklungsmöglichkeit einer Region.
Es ist ein bisschen widersinnig: Die Politik betont immer den deutschen Vorteil, dass unsere Wirtschaft so großflächig verteilt ist und nicht wie in anderen Ländern in wenigen Ballungsräumen stattfindet – aber die Konsequenz daraus – die ländlichen Räume zu stärken – wird nicht gezogen. Die Politik vertraut darauf, dass die Unternehmen trotzdem dort auf dem Land bleiben.
Zum guten Schluss: Was sind die Plagegeister der Region. Womit werden wir uns noch in 50 Jahren beschäftigen? Mit der Gäubahn?
Salomon: Das steht zu befürchten (lacht). Nein, ich denke, Mobilfunk und Breitband beschäftigen uns schon seit Jahren und Jahrzehnten und erschweren uns die Digitalisierung. Diese Themen werden uns noch sehr lange begleiten.
Das Gespräch führte Ulrike Heitze.
Bilder: Adobe Stock – lumikk555/Achim Mende
Porträtbilder (von oben nach unten): Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Villingen-Schwenningen, Dieter Salomon, Hauptgschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein, Freiburg und Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, Konstanz.