Viele rechtliche Änderungen zum Jahresstart haben wir bereits in den vergangenen Ausgaben größer vorgestellt. Nachfolgend aber noch mal eine Zusammenfassung über das, was kommt und was man dazu wissen muss.
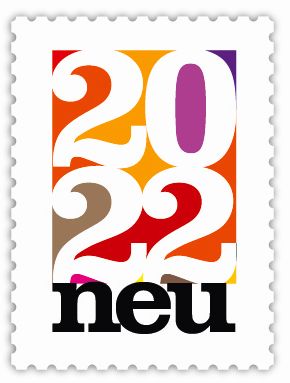
Mindestlohn & -ausbildungsvergütung
Der gesetzliche Mindestlohn für Arbeitnehmer steigt zum Jahreswechsel auf 9,82 Euro. Ab dem 1. Juli 2022 wird er dann auf 10,45 Euro erhöht. Anstellungen auf 450-Euro-Basis sind dadurch ab Jahresbeginn nur noch für rund 45, ab Mitte 2022 nur noch für 43 Stunden im Monat sozialversicherungsfrei. Bei Verträgen, die bereits die Grenze von 450 Euro voll ausschöpfen, sollte der Beschäftigungsumfang regelmäßig angepasst werden. Die neue Bundesregierung plant zudem, den Mindestlohn auf zwölf Euro anzuheben. Ab wann das gelten soll, ist noch offen.
Zum Jahresbeginn wird auch die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung für das erste Ausbildungsjahr auf 585 Euro angehoben. Im zweiten, dritten und vierten Lehrjahr gibt es Aufschläge: Die Vergütung muss je 18 Prozent, 35 Prozent und 40 Prozent über dem Einstiegsbetrag des ersten Ausbildungsjahres liegen.
Krankenversicherung bei Minijobbern
Arbeitgeber sozialversicherungsfreier Arbeitnehmer unterliegen seit dem 1. Januar einer Meldepflicht bezüglich der jeweiligen Krankenversicherung der Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber muss bei der Meldung des auf 450-Euro-Basis Angestellten bei der Minijob-Zentrale angeben, bei welcher (gesetzlichen) Krankenversicherung dieser für die Dauer der Beschäftigung versichert ist. Ziel ist die Verbesserung des Krankenversicherungsschutzes für kurzfristig Beschäftigte.
Geschlechterquote &#stayonboard
Mit dem sogenannten Zweiten Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II) wurde eine verbindliche Geschlechterquote für den Vorstand paritätisch mitbestimmter, börsennotierter Unternehmen eingeführt. Besteht dieser aus mehr als drei Mitgliedern, müssen mindestens eine Frau und ein Mann darin vertreten sein. Dies gilt bei der Bestellung neuer Vorstandsmitglieder ab dem 1. August 2022. Eine Bestellung entgegen dem Mindestbeteiligungsgebot ist nichtig und der Posten bleibt unbesetzt. Die Zielgröße von Null-Prozent Frauenanteil für den Aufsichtsrat, den Vorstand und die beiden obersten Führungsebenen unterhalb des Vorstands bleibt zwar weiter zulässig, unterliegt jedoch einer umfassenden Begründungspflicht. Diese entfällt, wenn bereits die verbindliche Geschlechterquote gilt. Zudem muss die Prozentangabe des Zielanteils eine volle Personenzahl ergeben.
Vorangetrieben durch die Initiative #stayonboard wird es Vorstandsmitgliedern zudem künftig ermöglicht, ihr Mandat in bestimmten Fällen bis zu zwölf Monate „ruhen zu lassen“, etwa nach der Geburt eines Kindes, im Sinne einer Elternzeit, zur Pflege von Angehörigen oder bei Krankheit. Der Aufsichtsrat beschließt dafür den Widerruf der Vorstandsbestellung, sichert aber zugleich die Wiederbestellung zu. Nach der alten Rechtslage musste das Amt im Falle einer solchen Auszeit aus Haftungsgründen regelmäßig niedergelegt werden.

Erleichterte Versammlungen für AG und GmbH
Die virtuelle Hauptversammlung geht in die dritte Saison. Die aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeführte und von der Praxis gut angenommene Möglichkeit, eine Hauptversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre abzuhalten, wurde bis zum 31. August 2022 verlängert.
GmbH-Gesellschafter haben ebenfalls bis Ende August die Möglichkeit, Gesellschafterbeschlüsse in Textform, also beispielsweise per E-Mail, oder durch schriftliche Stimmabgabe zu fassen, auch wenn weder der Gesellschaftsvertrag dies vorsieht, noch alle Gesellschafter damit einverstanden sind. Eine rein virtuelle Gesellschafterversammlung ist bei der GmbH weiterhin nur dann möglich, wenn dies im Gesellschaftsvertrag entsprechend geregelt ist.
Nachmeldungen zum neuen Transparenz-Vollregister
Das Transparenzregister wird vom bisherigen „Auffangregister“ zum Vollregister aufgewertet. Es enthält künftig die Daten der wirtschaftlich Berechtigten aller (Handels-)Gesellschaften, Vereine und Stiftungen. Wirtschaftlich Berechtigte sind die natürlichen Personen, die mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile oder Stimmrechte an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft halten oder kontrollieren. Demnach müssen nun die wirtschaftlich Berechtigten sämtlicher Rechtsformen ermittelt und zum elektronischen Transparenzregister nachmeldet werden. Je nach Gesellschaftsform endet die Meldefrist am 31. März (AG, SE, KGaA), 30. Juni (GmbH, [europäische] Genossenschaft, Partnerschaft) oder 31. Dezember 2022 (eingetragene Personengesellschaften).
Weitere Details: WiS 9-2021 sowie www.wirtschaft-im-suedwesten.de – Transparenzregister
Steuergleichstellung von Personen- und Kapitalgesellschaften
Ab dem Veranlagungsjahr 2022 besteht die Möglichkeit, Personengesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften wie Kapitalgesellschaften zu besteuern. Bei Letzteren erfolgt die Versteuerung von Gesellschaft und Gesellschaftern getrennt. Im Ergebnis führt dies zu einer betragsmäßig höheren Gewinnausschüttung. Die Gleichstellungsmöglichkeit soll die Steuerneutralität und Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaftsformen stärken. Ausgeschlossen sind die GbR und Einzelunternehmen.
Weitere Details: WiS 11-2021 sowie www.wirtschaft-im-suedwesten.de – Besteuerung wählen
Online: GmbH gründen, Handelsregister anmelden
Für die GmbH (und die UG) besteht ab dem 1. August 2022 die Möglichkeit einer Onlinegründung. Dabei erfolgt die notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages und der erforderlichen Willenserklärungen der Gesellschafter mittels eines besonders gesicherten Videokommunikationssystems der Bundesnotarkammer.
Auch Handelsregisteranmeldungen können in Zukunft mittels Videokommunikation beglaubigt werden, vorausgesetzt die Anmeldung erfolgt durch Einzelkaufleute oder Kapitalgesellschaften in der Rechtsform der AG, GmbH und KGaA. Bekanntmachungen der Eintragungen erfolgen dann nur noch durch die erstmalige Abrufbarkeit der Informationen über das Registerportal der Länder ( www.handelsregister.de). Das Abrufen von Daten aus dem Handelsregister ist ab dem 1. August gebührenfrei möglich.
Weitere Details: WiS 11-2021 sowie www.wirtschaft-im-suedwesten.de – GmbH gründen

Neuer Sachmangelbegriff im Kaufrecht
Im Juni 2021 wurde die EU-Warenkaufrichtlinie zur Harmonisierung des Kaufrechts umgesetzt. Die Gesetzesänderung gilt für Vertragsschlüsse ab dem 1. Januar 2022. Der neue Sachmangelbegriff ist die wichtigste Neuerung: Danach kann eine Sache mangelhaft sein, obwohl sie die vereinbarte Beschaffenheit hat. Bisher genießt eine subjektive Beschaffenheitsabrede Vorrang vor objektiven Anforderungen. Nach dem neuen Mangelbegriff ist neben der vereinbarten Beschaffenheit das Erfüllen objektiver Anforderungen maßgeblich, das heißt vor allem der „üblichen“ Beschaffenheit sowie Montageanforderungen. Darunter fallen insbesondere Montage- und Betriebsanleitungen. Bei B2B-Geschäften kann der Umfang der objektiv zu erwartenden Eigenschaften vertraglich vereinbart werden, im Verbrauchergeschäft nur unter strengen Voraussetzungen. Insbesondere muss die vertragliche Vereinbarung das Abweichen von der objektiv erwarteten „üblichen“ Beschaffenheit ausdrücklich festlegen. Ein allgemeiner Hinweis in den AGB oder in der Produktbeschreibung ist nicht ausreichend.
Beim Verkauf gebrauchter Waren an Verbraucher kann der Händler die gesetzliche Gewährleistungsfrist weiterhin verkürzen, aber nicht mehr in den AGB, sondern nur durch individualvertragliche Vereinbarung. Außerdem verlängert sich der Zeitraum der Beweislastumkehr für Mängel im B2C-Bereich (Verbrauchsgüterkauf) von einem halben auf ein ganzes Jahr: Tritt ein Mangel während dieser Zeit auf, wird vermutet, dass er schon bei der Übergabe der Ware vorlag. Der Verkäufer müsste das Gegenteil beweisen. Unternehmer sollten ihre Kaufverträge an die neuen Regelungen anpassen.
Weitere Details: WiS 9 und 11-2021 sowie www.wirtschaft-im-suedwesten.de – EU-Warenkaufrichtlinie und EU-Kaufrecht
Verbrauchervertrag über digitale Produkte
Das Kaufrecht enthält in seiner neuen Fassung auch den neuen „Verbrauchervertrag über digitale Produkte“ nebst Gewährleistungsrecht. Unter die neue Vertragsart fallen beispielsweise Verbraucherverträge über Smartphones, Smartwatches, digitale Sprachassistenten, smarte Fernseher und Stereoanlagen sowie digitale Haushaltsgeräte oder Spielekonsolen. Neben den Gewährleistungsrechten hat der Verkäufer künftig eine Aktualisierungspflicht. Stellt der Verkäufer innerhalb der üblichen Nutzungsdauer des Produkts keine Updates bereit, liegt darin ein Sachmangel. Davon betroffen sind vor allem Aktualisierungen, welche die Funktionsfähigkeit und die IT-Sicherheit des Produkts gewährleisten. Funktionsverbesserungen sind nicht geschuldet. Verkäufer von digitalen Produkten, die diese nicht selbst herstellen, sollten daher mit dem Hersteller die Modalitäten der Aktualisierung vertraglich vereinbaren, um ihre Aktualisierungspflicht abzusichern. Zudem wird auch die Frage nach der Dauer des Zeitraums für die Bereitstellung der Updates regelungsbedürftig sein, da dies gesetzlich nicht festgelegt ist. Dieser muss mindestens die Dauer der gesetzlichen Gewährleistung (zwei Jahre) betragen und kann durch Vereinbarung nicht verkürzt werden. Denkbar ist, dass digitale Produkte künftig mit einem „Haltbarkeitsdatum“ verkauft werden, das der zu erwartenden Produktlebensdauer entspricht.
Weitere Details: WiS 9 und 11-2021 sowie www.wirtschaft-im-suedwesten.de – EU-Warenkaufrichtlinie und EU-Kaufrecht
Automatische Verlängerungen nur noch eingeschränkt
Für Dauerschuldverhältnisse im B2C-Bereich, die ab dem 1. März 2022 geschlossen werden, verändern sich die gesetzlichen Regelungen zur stillschweigenden Verlängerung. Eine automatische Verlängerung um ein Jahr, bei einer vorherigen Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten, ist nicht mehr wirksam. Stillschweigende Verlängerungen sind nur noch zulässig, wenn sich das Dauerschuldverhältnis auf unbestimmte Zeit verlängert und vom Verbraucher monatlich kündbar ist. Unternehmen sollten ihre AGB bis zum 1. März anpassen. Entgegenstehende Klauseln werden ab diesem Zeitpunkt unwirksam.
Bei online geschlossenen kostenpflichtigen Dauerschuldverhältnissen im B2C-Bereich sind Unternehmen ab dem 1. Juli verpflichtet, auch eine Onlinekündigung anzubieten. Dies soll über eine gut sichtbare und eindeutig beschriftete Schaltfläche („Kündigungsbutton“) ermöglicht werden. Die Schaltfläche zur Kündigung muss den Verbrauchern gut auffindbar dargestellt werden und ständig verfügbar sein. Gibt es bis zum Stichtag keinen solchen Kündigungsbutton, können Verbraucher fristlos kündigen.
Text: Barbara Mayer,
Friedrich Graf von Westphalen & Partner
Bilder: Adobe Stock
