Ein kürzlich abgeschlossenes Pilotprojekt zeigt: Nachhaltigkeit lässt sich in Zahlen fassen und so in der Bilanz abbilden. Noch ist das keine Pflicht, doch das Thema kommt auch von Kunden- und Investorenseite auf die Wirtschaft zu. Wir stellen Unternehmen vor, die schon nachhaltig agieren.
Dass sich der Begriff „enkeltauglich“ zum Modewort entwickelt hat, zeigt: Auch wenn bislang nur wenige börsennotierte Unternehmen tatsächlich verpflichtet sind, ihre Bilanz um einen Nachhaltigkeitsbericht zu ergänzen, ist das Thema Nachhaltigkeit längst in der Wirtschaft angekommen. Dafür sorgen heiße, trockene Sommer ebenso wie der von der EU angekündigte „Green Deal“. Häufig wird der Satz des Investmentbankers Larry Fink (Blackrock) „Klimarisiken sind Anlagerisiken“ zitiert, um die Zusammenhänge zu verdeutlichen. In sterbende Branchen will niemand investieren. Und dass Veränderungen mitunter disruptiv sein können, haben die vergangenen Jahre deutlich gezeigt.
Das Kleeblatt

Das Projekt Quartavista, das Nachhaltigkeit in die Buchhaltung integriert, hat sich ein Kleeblatt als Logo gewählt. Die vier Blätter stehen für die klassischen Bilanzinhalte, nämlich Finanzen, und für die drei neuen Themen Ökologie, Soziales und Wissen.
Der Druck auf Unternehmen wächst also. Die Handlungsempfehlungen, was genau sie tun können, bleiben indes sehr vage. Hier könnte ein jüngst beendetes Pilotprojekt konkretere Wege zeigen: Quartavista hat bewiesen, dass Nachhaltigkeit in der Bilanz abgebildet werden kann. Und zwar ganz monetär in Zahlen. Der Walldorfer Softwarekonzern SAP hat dafür eines seiner Produkte um Leistungskennzahlen aus dem Nachhaltigkeitsbereich ergänzt. Der Prototyp enthält 40 Aufwandspositionen, die die Projektpartner definiert und in die Bilanz integriert haben. Dabei haben sie die drei klassischen Nachhaltigkeitsthemen Ökonomie, Ökologie und Soziales um den vierten Bereich Wissen ergänzt. Deshalb heißt das Projekt Quartavista (lateinisch: vier Blickwinkel) und das Logo besteht aus vier bunten Kleeblättern. Rechenbeispiel zum Thema Wissen: Wenn der Betrieb ausbildet, entstehen ihm nach der Quartavista-Methodik nicht nur Kosten, sondern er kann das aufgrund der Ausbildung aufgebaute und bewahrte Wissen auch mit den entsprechenden Kennzahlen auf der Vermögensseite verbuchen.
Dieses Prinzip hat die Regionalwert AG aus Eichstetten am Kaiserstuhl entwickelt, einer der Projektpartner von Quartavista. Das Bundesarbeitsministerium hat das Modellprojekt während seiner zweijährigen Laufzeit gefördert. Vier Unternehmen – außer Regionalwert die Bingenheimer Saatgut AG aus der Wetterau, der Naturkostgroßhandel Bodan aus Überlingen am Bodensee und die Bohlsener Mühle in der Lüneburger Heide – haben die nachhaltige Buchführung in der betrieblichen Praxis erprobt. Das Ergebnis: Es funktioniert.

Entsprechend euphorisch klangen die Reden bei der Quartavista-Abschlusspräsentation im Frühjahr. „Wir hoffen auf den Beginn einer neuen Zeitrechnung, auf die Reform der Bilanzbuchhaltung zur ökologisch-ökonomischen Wende“, sagte Christian Hiß (Bild). Der Geschäftsführer der Regionalwert AG ist der Initiator des Projekts. Er kennt das Problem der vollständigen betrieblichen Erfolgsmessung noch aus seiner Zeit als Biolandwirt: „Wir rechnen die Verluste, die der ländliche Raum erlebt, nicht ein“, sagt Hiß. Das fördere eine fatale Entwicklung. Investitionen in die künftige Fruchtbarkeit des Bodens zahlten sich für den Landwirt nicht aus. Investiert er dennoch, entstehen Kosten, die im Aufwand auftauchen und abgestraft werden. Einen „fatalen Konstruktionsfehler“, nennt Hiß das, in dessen Folge große Werte verloren gehen.
Das Thema treibt ihn seit vielen Jahren um. Deshalb hat Hiß nach der Land- auch Betriebswirtschaft studiert, 2006 seine Regionalwert AG als Bürgeraktiengesellschaft gegründet und in deren Satzung geschrieben, dass soziale und ökologische Leistungen als Rendite zu sehen sind. Als Basis dienen die von den Vereinten Nationen definierten 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, die „Sustainable Development Goals“, kurz: SDG. So will er das Finanzierungsproblem in der Biolandwirtschaft verbessern (mehr dazu hier). Parallel hat Hiß sich dem Thema Buchführung gewidmet – damit nicht nur das eigene, sondern alle Unternehmen richtig rechnen.
Das Brett, das Hiß bohrt, ist sehr dick. Seine Methode: durchhalten, dranbleiben, abchecken. Er geht auf die Leute zu, spricht sie an. So ist er schon vor vielen Jahren zum Institut für Wirtschaftsprüfer (IDW) gefahren und konnte dessen Leiter für Nachhaltigkeit für seinen Ansatz gewinnen. Jetzt saß IDW-Experte Matthias Schmidt auf dem Podium der Quartavista-Abschlusspräsentation. Auf seinem langen Weg ist Hiß vielen einflussreichen Menschen begegnet, etwa dem Gründer des Davoser Wirtschaftsforums Klaus Schwab und sogar Kanzlerin Angela Merkel. Er hat immer wieder Preise gewonnen, 2010 beispielsweise den Deutschen Nachhaltigkeitspreis oder 2020 den Preis für Nachhaltigkeit von „Zeit Wissen“. Und es sind andauernde Beziehungen entstanden wie zu dem Umweltwissenschaftler Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der die Schlussworte bei der Quartavista-Präsentation sprach. Der Kontakt zu SAP kam über eine Doktorandin zustande, die innerhalb eines Mentoringprogramms der Uni Heidelberg, an dem Hiß beteiligt war, über die Regionalwert AG promovierte, anschließend RW-Aktionärin wurde und bei SAP arbeitete. Sie stellte 2017 den Kontakt zu ihrem Chef her, in der Folge fuhr Christian Hiß nach Walldorf. Es gab Vorgespräche, man arbeitete zusammen das Pilotprojekt aus, akquirierte Fördermittel vom Bundesarbeitsministerium, suchte und fand weitere Projektpartner.
Wie geht es mit Quartavista jetzt weiter? Hiß macht das, was er seit 15 Jahren tut. Er knüpft weiter Kontakte, etwa zu Banken, Berufsgenossenschaften, zum Bundesjustizministerium und auch zur IHK.
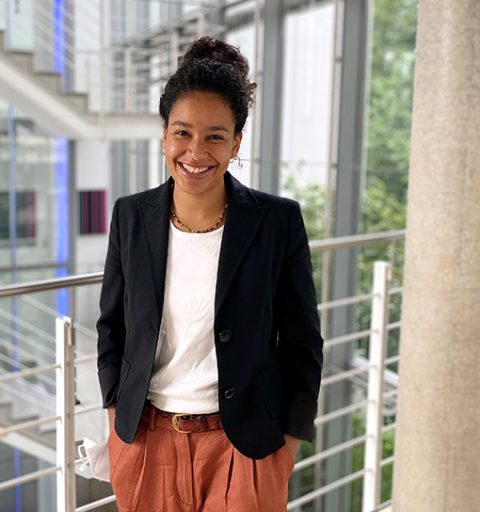
Erste Gespräche mit Hauptgeschäftsführung und den Umweltexperten gab es bereits, und die IHK Südlicher Oberrhein hat Unterstützung für Quartavista signalisiert. Denn sie beobachtet bei den Unternehmen Unsicherheit, wie sie sich in Sachen Nachhaltigkeit aufstellen sollen. Der richtige Rahmen fehlt ja noch. „Viele wissen nicht so richtig, wo sie anfangen sollen“, sagt Jil Munga (Bild), Referentin für Klima und Ressourceneffizienz der IHK Südlicher Oberrhein. Die Firmen müssten ja erstmal in Vorleistung gehen, wenn sie bislang externe Kosten internalisieren. Gesetzliche Vorgaben könnten das ändern. „Aber es wird kein Unternehmen daran gehindert, jetzt schon aktiv zu werden“, betont Munga. Beispielsweise beim Austausch eines Heizkessels. Wenn man den sogenannten CO2-Schattenpreis eines Erdgaskessels berücksichtige und mit einem Pelletkessel vergleiche – nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern über den gesamten Lebenszyklus – dann sei er in keinem Fall mehr die richtige Investition (zum ausführlichen Interview mit Jil Munga: www.wirtschaft-im-suedwesten.de/2021/07/01/nachhaltigkeit/).

Lebenszykluskosten findet auch Michael Zierer (Bild) wichtig. Der Experte für Umwelt und Energie der IHK Hochrhein-Bodensee hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Unternehmen in der Region dazu zu bringen, genauer hinzusehen. Denn wenn man die gesamten Kosten, die ein Produkt, eine Maschine oder eine Technologie im Lauf ihres Einsatzes verursacht, betrachtet, ergeben sich ganz andere Rechnungen als etwa die Anschaffungskosten suggerieren. „Viele Geräte kosten im Lauf ihrer Nutzung ein Vielfaches ihrer Anschaffungskosten“, sagt Zierer. Er sieht das Problem in einem System, das auf Kosten- statt auf Energieeffizienz, auf Gewinn- statt auf Nachhaltigkeitsmaximierung setzt. Deshalb versuchten Firmen, bei Umweltstandards den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Das sei weniger anstrengend und aufwendig, schlicht: menschlich. Zudem denken gerade große, vor allem börsennotierte Unternehmen oft in kurzen Zeitspannen und nicht unbedingt an die übernächste Generation (zum ausführlichen Interview mit Michael Zierer: www.wirtschaft-im-suedwesten.de/2021/07/01/nachhaltigkeit/).
Energiewende-Barometer

Die IHKs fragen Unternehmen jährlich, wie sie die Auswirkungen der Energiewende auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit beurteilen. Im jüngsten „Energiewende-Barometer“ bewerten die Betriebe sie eher als Herausforderung, denn als Chance. Auf einer Skala von minus 100 („sehr negativ“) bis plus 100 („sehr positiv“) lag der Wert über alle Branchen hinweg 2020 bei minus 2,5. Eher positiv schätzen Bau- (plus 10) und Dienstleistungsunternehmen (plus 6) die Auswirkungen der Energiewende für sich ein. Im Handel (minus 4) und vor allem in der Industrie (minus 19) überwiegt die Skepsis. Sorgen bereiten vor allem hohe Energie- und Stromkosten in Deutschland den energieintensiveren Branchen im internationalen und europäischen Wettbewerb.
Die Befragung fand im Oktober 2020 statt. Deutschlandweit haben sich daran 2.599 Unternehmen beteiligt – 35 Prozent davon aus der Industrie, 4 Prozent aus der Bauwirtschaft, 16 Prozent aus dem Handel und 44 Prozent aus dem Dienstleistungssektor.
wis
Dabei kommt das Thema von ganz anderer Seite auf die Unternehmen zu. „Der Gesetzgeber ist uninteressant“, meint Zierer. „Interessant ist, was Kunden verlangen.“ Und zwar sowohl Verbraucher als auch Firmenkunden. Denn wenn beispielsweise die Automobilindustrie grüner werden will, verlangt sie das gleichermaßen von ihren Zulieferern. „Nachhaltigkeit spricht nicht gegen Gewinnmaximierung. Die fördert sie sogar langfristig“, betont Zierer. Zudem sieht der IHK-Experte Klimaschutz aus ganz praktischen Gründen relevant für die Wirtschaft: Wenn Temperaturen steigen und Dürreperioden zunehmen, dann erschwert das nicht nur die Landwirtschaft und gefährdet die Eigenversorgung. Es betrifft auch viele Unternehmen. „Wasser ist ein zentrales Thema“, sagt Zierer. „Das brauchen alle.“ Vor allem an Hochrhein und Schluchsee, wo Wasserkraft zur Stromgewinnung genutzt wird. Niedrigwasser gefährdet hier die Energieversorgung und die Schifffahrt.
Der Rhein spielt auch für den Standort Rheinfelden von Evonik eine wichtige Rolle – allerdings nicht als Transportweg, sondern als Kühlwasserlieferant. Das Chemiewerk überwacht die Temperatur des Rheins sowie des entnommenen Kühlwassers genau und passt gegebenenfalls, wie im heißen Sommer 2018 geschehen, die Produktion an. Evonik beschäftigt in Rheinfelden knapp 1.200 Mitarbeiter und erzeugt vor allem drei Produktgruppen: Wasserstoffperoxid, das zur Desinfektion und Reinigung beispielsweise von Joghurtbechern oder Leiterplatten genutzt wird. Das auf Silicium basierende Produkt Aerosil, das etwa dafür sorgt, dass Dämmungen in Kühlschränken dünner und die Geräte damit effizienter oder Autoreifen spritsparender werden. Und schließlich Silane, die zum Beispiel in Glasfaserkabeln oder als Korrosionsschutz in Beton zum Einsatz kommen. Sie verlängern die Haltbarkeit des Baustoffs und reduzieren so indirekt CO2-Emmissionen, die bei dessen Herstellung entstehen. Auch viele andere der insgesamt mehr als 400 Produkte, die in Rheinfelden entstehen und ausschließlich an Industriekunden geliefert werden, dienen mittelbar dem Umweltschutz, indem sie etwa zur Energieeffizienz beitragen. „Next-Generation-Solutions“ nennt Evonik diese Angebote, die konzernweit gut ein Drittel des Umsatzes ausmachen.

Natürlich ist auch der eigene Energiebedarf ein stetes Thema am Standort. „Unsere Prozesse sind stromintensiv beziehungsweise stark dampfgetrieben“, sagt Standortleiter Olaf Breuer (Bild) Dabei spielt Wasserkraft, die Ende des 19. Jahrhunderts der Grund für die Ansiedlung der Industrie am Hochrhein war, immer noch eine wichtige Rolle: Die Hälfte des von Evonik verbrauchten Stroms stammt aus Wasserkraft, die andere Hälfte aus einer eigenen Gasturbine. Der hohe Energieverbrauch und die große Menge an verfügbarer Abwärme sind die Motivation für zwei Nachhaltigkeitsprojekte des Evonik-Standorts. Zum einen will man die momentan noch traditionell „graue“, also konventionelle Wasserstofferzeugung effizienter gestalten, entweder „blau“ (sodass das dabei entstehende CO2 gebunden wird), „grün“ (CO2-frei und mit Strom aus erneuerbaren Energien) oder „türkis“ (dabei entsteht Methanol, das Evonik ohnehin braucht). „Das Verfahren soll ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein“, sagt Breuer. Derzeit laufen Gespräche mit möglichen Projektpartnern. Details zur Größe und Investitionshöhe darf der Standort nicht publizieren.
Das andere Projekt ist schon etwas konkreter: Evonik stellt dem Versorgungsunternehmen Energiedienst Abwärme zur Verfügung, das damit ein Wärmenetz aufbaut und Strom erzeugt. Mit den Stadtwerken Rheinfelden realisiert Evonik ein ähnliches Vorhaben. Bislang geht es dabei nur um einen kleinen Teil der bei Evonik anfallenden Wärme. Das Projekt könnte noch viel größer werden. Die Idee ist, entlang des Hochrheins ein Wärmenetz aufzubauen. Dafür arbeitet Evonik mit anderen Chemie- und Pharmaunternehmen zusammen, denn die Redundanz braucht es für die Versorgungssicherheit, erklärt Breuer. Auch sonst will die Chemiebranche Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sein. „Wir sehen, dass man das Thema auf allen Ebenen und in allen Branchen anpacken muss“, konstatiert Breuer. „Als chemische Industrie sind wir ein Treiber der Veränderung.“ Das gelte nicht nur für den Standort Rheinfelden, sondern für den ganzen Konzern. Die Zentrale in Essen hat eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und zehn Nachhaltigkeitsziele definiert. Der Fokus liegt auf Energie, Wasserstoff und Abwärme. Die Motivation in Sachen Nachhaltigkeit sei vielschichtig und längst nicht mehr nur monetär, betont Breuer: Das komme zum einen natürlich von der Marktseite. „Viele Kunden fragen nach nachhaltigen Produkten“, berichtet Breuer. Und andererseits von den eigenen Mitarbeitern. Ein großer Teil der Ideen, die sie im kontinuierlichen Verbesserungsprozess des Standorts einbringen, diene dem Klima- und Umweltschutz. „Der Drive kommt aus der Belegschaft“, sagt Breuer.

Das Personal sieht Marcel Trogisch (Bild) als eine wichtige Motivation und zugleich als wertvollen Ideengeber für nachhaltiges Engagement: „Um langfristig erfolgreich agieren zu können, brauchen Unternehmen zufriedene Mitarbeiter – und eine intakte Umwelt“, sagt der Referent Energie und Umwelt der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Thema Klimaschutz sei seit einigen Jahren so präsent – „dem kann man sich nicht entziehen“. Trogisch leitet den Arbeitskreis Energieeffizienz seiner IHK und sieht dort zahlreiche spannende Projekte. Bei vielen sei natürlich die Kostenersparnis der Treiber. Außerdem versprechen sich die Firmen Erleichterungen – beispielsweise weniger Stromsteuern oder längere Prüffristen aufgrund einer EMAS-Zertifizierung. Trogisch sieht aber auch Unternehmen, die mehr tun, sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben und so wahrgenommen werden wollen. „Das wird immer mehr so kommen“, glaubt der IHK-Experte (zum ausführlichen Interview mit Marcel Trogisch: www.wirtschaft-im-suedwesten.de/2021/07/01/nachhaltigkeit/)
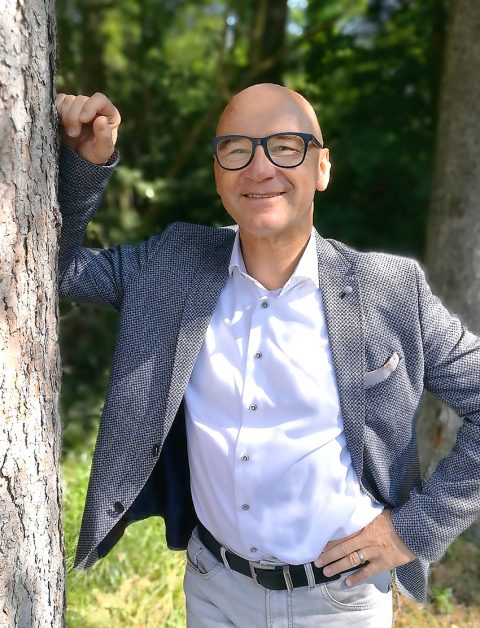
Die Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH & Co. KG fällt eindeutig in diese Kategorie. Geschäftsführer Ulrich Lössl (Bild) weiß, dass eine intakte Natur zentral für sein Unternehmen ist: „Das ist unsere Existenzgrundlage, die müssen wir langfristig erhalten.“ Deshalb lässt er seine Marke biozertifizieren. Aber kann Mineralwasser überhaupt bio sein? Schließlich ist es qua Definition naturbelassen. Oder anders gefragt: Gibt es Mineralwasser, das nicht bio ist? Die EU verleiht ihr Biosiegel bislang nicht an Mineralbrunnen. Die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser, der alle Bioverbände angehören, vergibt dagegen ein privatrechtliches Biosiegel an Mineralbrunnen, wenn diese ein aufwendiges Zertifizierungsverfahren absolviert haben. Dabei geht es nicht nur um die besondere Reinheit des Mineralwassers, sondern auch um deren langfristige Erhaltung und um eine soziale Komponente, einen wertschätzenden Umgang mit allen Menschen. Lediglich 12 der 200 deutschen Mineralbrunnen tragen dieses Biosiegel, darunter Bad Dürrheimer. Rund 150 zusätzliche Parameter lassen die Biomineralbrunnen ständig analysieren, um ihre Reinheit zu belegen. Das hat auch den Bundesgerichtshof überzeugt, der die Zulässigkeit des Siegels 2012 bestätigte.

Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg startet zusammen mit dem Land das Projekt „Klimafit“, um vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen den Einstieg in die Themen Klimaschutz und Energieeffizienz zu erleichtern. Das Projekt ist kostenpflichtig, kann aber bezuschusst werden. Es läuft über mehrere Monate und beinhaltet diverse Workshops. Klimafit soll im Herbst starten. Noch sind Plätze frei.
www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de ( 5039426)
Die IHK Südlicher Oberrhein will mit ihrem Projekt „Zielgerade 2030“ Firmen für den Klimaschutz begeistern. Sie bietet Dienstleistungen wie CO2-Bilanzierung und Maßnahmenpläne zur Klimaneutralität an. Der Preis richtet sich nach der Unternehmensgröße. Zugleich sollen Best-Practice-Beispiele für Nachhaltigkeit werben. www.zielgerade2030.de
Die IHK Hochrhein-Bodensee lädt zu zwei Onlineseminaren ein: Am 21. September (13.30 -17 Uhr) geht es um „Klimaschutzgesetz & IEKK“ und am 23. September (13.30-17 Uhr) um „Einsparpotenziale im Unternehmen“
www.konstanz.ihk.de ( 143151321 bzw. 143151324)
Umweltschutz wird bei Bad Dürrheimer von vielen Seiten angepackt: etwa mit sparsamem Ressourcenumgang, dem Bezug von Ökostrom, der Entscheidung, klimaneutral zu produzieren und zwar im strengen Sinne („Scope 3“) oder der Umstellung auf komplett recycelte PET-Flaschen. Nachhaltig wird das ökologische Engagement nach Lössls Auffassung allerdings erst im Zusammenspiel mit Sozialem und Wirtschaft. Dass die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser genau diese drei Handlungsfelder vorschreibt, hat ihm die Überzeugungsarbeit im Unternehmen erleichtert. „Es gab anfangs auch viel Skepsis“, berichtet er. Um alle „mitzunehmen“, wie er sagt, hat Lössl die ökologischen auch zu sozialen Projekten gemacht. So unterstützt Bad Dürrheimer beispielsweise die Initiative Baar-Food, die sich für ökologische und solidarische Landwirtschaft auf der Baar einsetzt, nicht nur finanziell, sondern auch tatkräftig. Etliche der 140 Mitarbeiter packen auf dem Gemüseacker mit an und bekommen dabei einen neuen Bezug zu ihrer Heimat und zur Natur. Mitnehmen will Lössl auch die einheimische Bevölkerung, bei der er für Boden- und Wasserschutz sowie Artenvielfalt wirbt. Bei dem von seinem Mineralbrunnen initiierten Projekt „Bad Dürrheim blüht auf“ gibt es beispielsweise Samen für Blühwiesen oder -streifen. So ist ein engagiertes Netzwerk aus Bauern, Bürgern, Umweltexperten zusammengewachsen. „Das ist mittlerweile ein Selbstläufer, da müssen wir gar nicht mehr viel machen“, sagt Lössl. Er kann sich deshalb wieder um neue Projekte kümmern – zum Beispiel die Schorle „Streuobst Schätzle“, die den Erhalt von ökologisch wertvollen Obstwiesen unterstützt oder den „Green Event Guide“. Wer sich von Bad Dürrheimer sponsern lassen will, soll seine Veranstaltung umweltfreundlich organisieren „Wir versuchen in die Sponsorings möglichst viel Nachhaltigkeit zu bringen und unsere Partner als Multiplikatoren zu sehen“, erklärt Lössl.
Er schätzt den Mehraufwand, den sein Unternehmen insgesamt in Sachen Nachhaltigkeit betreibt, auf einen „gut sechsstelligen Betrag“. Lössl ist überzeugt, dass sich dieses Engagement nicht nur für die Natur, sondern auch für den langfristigen Unternehmenserfolg auszahlt. Denn damit könne sich Bad Dürrheimer deutlich und glaubhaft von der Konkurrenz abheben. Seit einigen Jahren sinkt der Mineralwasserabsatz in Deutschland. Bad Dürrheimer verzeichnet zwar auch leichte Verluste. Die sind laut Lössl aber deutlich geringer als bei vielen Mitbewerbern. Der Absatz liegt ziemlich konstant bei circa 120 Millionen Flaschen oder knapp einer Million Hektoliter jährlich. Hier rechnet sich Nachhaltigkeit also.
Text: Kathrin Ermert
Titelbild: imacoconut – iStock
IHK-Ansprechpartner
Michael Zierer
Telefon: 07622 3907-214
Mail: michael.zierer@konstanz.ihk.de
Marcel Trogisch
Telefon: 07721 922-170
Mail: trogisch@vs.ihk.de
Jil Munga
Telefon: 0761 3858-263
Mail: jil.munga@freiburg.ihk.de
