Im März vergangenen Jahres war fast über Nacht auf einmal alles anders: Der erste Lockdown legte einen großen Teil der Wirtschaft praktisch lahm, die Arbeit in den Betrieben, die offen blieben, musste neu organisiert werden. Ein Jahr später ist längst noch nicht alles, wie es einmal war. Wir werfen einen Blick in verschiedene Branchen der Region, ziehen eine erste Bilanz nach einem Jahr Corona und wagen einen Ausblick. Redaktionsschluss war der 18. Februar.

Einzelhandel
„Es ist ein Desaster – insbesondere für Bekleidungs- sowie Schuhgeschäfte und Parfümerien, aber auch für Kauf- und Warenhäuser und Sportgeschäfte, die in der Innenstadt angesiedelt sind.“ Mit diesen Worten beschreibt Peter Spindler, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Südbaden, die Lage des Einzelhandels. Während die Branche 2020 deutschlandweit vor allem wegen des boomenden Online- und Versandhandels um 3,9 Prozent zulegte, verbuchten die stationären Mode- und Schuhhändler einen Umsatzrückgang von 23,4 Prozent. Der erste Lockdown im März 2020 sei für die Händler ein Schock gewesen, allen voran für die Modegeschäfte, die ihre Lager mit der neuen Frühjahrsware gefüllt hatten, die sie später im Jahr, wenn überhaupt, dann nur mit Abschlägen verkaufen konnten. Während es im Sommer für die Branche wieder einigermaßen lief, „fing es ab Oktober erneut an, schwierig zu werden“, sagt Spindler und nennt den Appell von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Kontakte zu reduzieren, als Grund. Verschärft wurde die Situation ab November: Mit dem „Lockdown light“ ging die Zahl der Kunden deutlich zurück, bis sie ab Mitte Dezember mit den verordneten Schließungen auf null sank. „Ganz schlimm ist, dass das Weihnachtsgeschäft gänzlich weggebrochen ist und dass die Aussichten, 2021 mit einem vernünftigen Ergebnis rauszukommen, von Tag zu Tag schwinden“, so Spindler. Die Mode- und Schuhhändler stehen zudem vor demselben Problem wie vor einem Jahr: Wieder sind die Lager voll, da sie bereits im Herbst die aktuelle Frühjahrsmode bestellen mussten, und wieder wissen sie nicht, wann oder ob sie diese verkaufen können. Auch wenn die meisten weniger als sonst bestellt haben, sind viele derzeit gezwungen, sich mit Krediten über Wasser zu halten, berichtet Spindler. Der Impfstoff sei ein Hoffnungsschimmer gewesen, der sich aber – angesichts der Dauer des zweiten Lockdowns – immer mehr zerschlagen habe. Die Möglichkeit, bei ihnen vorab bestellte Waren abzuholen, sei für viele Händler nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Spindler rechnet „mit erheblichen Ladenschließungen in Südbaden und Problemen, die auf alle Innenstädte zukommen“.

Industrie
Natürlich ist auch die regionale Industrie von den Folgen der Pandemie betroffen, allerdings weniger stark als beispielsweise die Veranstaltungsbranche oder der Handel, wie Christoph Münzer betont. Der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands industrieller Unternehmer Baden (WVIB) sagte Anfang Februar vor der Presse: „Corona trifft die Industrie hart, aber nicht frontal.“ Der Umsatz der Mitgliedsunternehmen ging 2020 durchschnittlich um 8,42 Prozent zurück. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, an der sich 400 der über 1.000 Mitgliedsunternehmen beteiligten. Bereits im Vorjahr meldeten sie einen – allerdings kleinen – Rückgang von 0,12 Prozent vor allem wegen der Transformation der Automobilindustrie. 2020 indes erlebte die Industrie, so wie das Gros der Wirtschaft, ein Auf und Ab: Nach einem Umsatzrückgang um zwölf Prozent im ersten Halbjahr gab es „eine Aufholjagd, die durch den zweiten Lockdown gebremst wurde“, so Münzer. Die stärksten Rückgänge verbuchte die Mess- und Regeltechnik, gefolgt von Automotive, Metallverarbeitung sowie Maschinenbau, Konsumgüter und Medizintechnik. Allerdings sind die Unternehmen der einzelnen Branchen unterschiedlich betroffen. Medizintechnikunternehmen, die Schutzkleidung und andere Hygieneprodukte herstellen, legten natürlich zu. Und die Automobilzulieferer profitierten von den wieder steigenden Exporten nach China und in die USA, wie Thomas Burger, WVIB-Präsident und geschäftsführender Gesellschafter der Burger Group aus Schonach, berichtet. Die Erwartungen sind besser als vor einem Jahr: 42 Prozent der Befragten rechnen in den nächsten sechs Monaten mit steigenden (Vorjahr: 26 Prozent), 46 Prozent mit gleichbleibenden (49 Prozent) und 12 Prozent (25 Prozent) mit sinkenden Umsätzen. Der Auftragseingang ist in der Industrie durchschnittlich um knapp fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. „Das ist nicht so gut wie geplant, aber besser als zwischendurch befürchtet“, so Münzer.

Hotellerie und Gastronomie
Ungleich mehr als die Industrie, aber ebenfalls unterschiedlich leiden Gastronomie und Hotellerie seit einem Jahr: Allen machen die Lockdowns und die unklaren Aussichten zu schaffen. Doch während auf Urlauber spezialisierte Hotels und Gaststätten vor allem im Schwarzwald und am Bodensee im Sommer gute Geschäfte machen konnten, mussten die auf Tagungen, Geschäftsleute und Reisegruppen spezialisierten Häuser und auch andere Stadthotels das ganze Jahr über massive Einbußen hinnehmen, wie Alexander Hangleiter, Leiter der Geschäftsstelle Freiburg des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), betont. Ausnahmen seien einzelne, beispielsweise in der Nähe von Großbaustellen gelegene Häuser, die die dortigen Arbeiter beherbergen. Auch auf Veranstaltungen spezialisierte Restaurants sowie Cateringunternehmen leiden besonders. Für das gesamte Gastgewerbe rechnet Hangleiter mit einem Umsatzrückgang von rund 50 Prozent im vergangenen Jahr. Schlusslichter sind Clubs und Diskotheken, die seit Mitte März 2020 geschlossen sind. „Wie die überleben sollen, weiß ich nicht“, sagt er. Laut einer Umfrage des Dehoga vom Januar bangen 75 Prozent der Mitgliedsbetriebe in Baden-Württemberg um ihre Existenz, ein Viertel zieht konkret in Betracht zu schließen. „Uns liegen immer mehr Gewerbeabmeldungen vor“, berichtet Hangleiter. Er befürchtet, dass viele Betriebe dauerhaft abgemeldet bleiben, häufig mit Schulden, aber ohne Insolvenz anzumelden, so dass sie auch in keiner Insolvenzstatistik auftauchen werden. Dem gegenüber steht ein „Interesse an Existenzgründungen“, das der gelernte Hotelfachmann und Jurist ebenfalls beobachtet – wie es nach Krisen häufig der Fall ist.
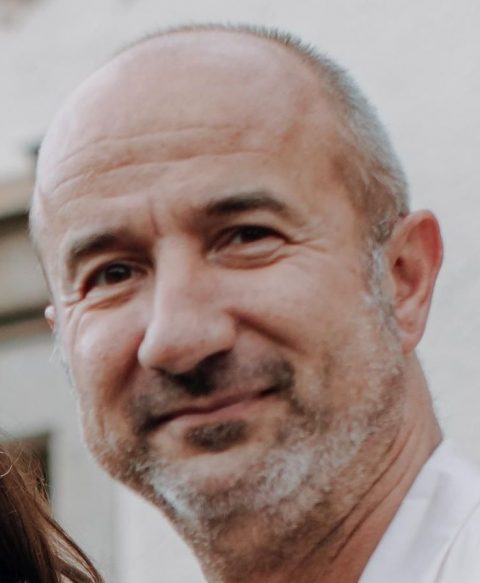
Tourismus
„Wir waren es gewöhnt, immer wieder von Rekordzahlen zu sprechen“, sagte Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG), Ende Januar auf der Stuttgarter Tourismusmesse CMT online. Nun habe sich die Situation „von Overtourism zu zero Tourism“ entwickelt, spitzte er zu. Für 2020 rechnet er mit rund 30 bis 40 Prozent weniger Ankünften und Übernachtungen im Schwarzwald (die genauen Zahlen standen Ende Januar noch nicht fest, siehe zum Tourismus auch Kasten Seite 10). Januar und Februar 2020 seien noch sehr gut gelaufen. Nach dem ersten Lockdown war die Branche hoffnungsfroh, der Sommer sehr gut. „Der zweite Lockdown war für uns ein harter Lockdown“, sagte Mair mit Blick auf die Teilschließungen ab November. Gastronomie, Hotellerie, Campingplatzbetreiber, Kleinvermieter und die Eventbranche bräuchten dringend die staatlichen Hilfen, betonte Mair und kritisierte die schleppende Auszahlung. Er pochte zudem auf zügige Impfungen. Die seien ein psychologischer Anker für die Branche, um wieder planen zu können. Denn die Betriebe könnten nicht von heute auf morgen aufmachen, sie brauchten Vorlauf und Planungssicherheit. „Ich hoffe, dass möglichst viele Betriebe diese schwierige Zeit überwinden“, so Mair. Angesichts der ausgesetzten Insolvenzpflicht gibt es von der STG derzeit noch keine Einschätzung zu möglichen Insolvenzen. Außerdem sind etwa zwei Drittel der rund 12.000 Gastgeber im Schwarzwald im Nebenerwerb tätig, sodass sie im Zweifelsfall gar nicht Insolvenz anmelden würden. Nichtsdestotrotz ist Mair zuversichtlich, dass der Schwarzwald als Gewinner aus der Pandemie hervorgeht. „Die Menschen suchen nach Vertrauen, Sicherheit und Nähe“ – all dies biete der Schwarzwald. Und auf den 24.000 Kilometern Wanderwege trete man sich nicht auf die Füße.

Fitnessstudios
In ihrer Existenz bedroht sieht Frank Jäger, Studioleiter des Rückgrats in Donaueschingen, viele Unternehmen seiner Branche aufgrund der Coronapandemie – sein eigenes eingeschlossen. „Wir gehen aber davon aus, dass wir die Krise überstehen, wenn auch mit einer reduzierten Mitarbeiterzahl“, sagt er. Das Fitnessstudio wurde 1993 gegründet, beschäftigt 13 festangestellte Mitarbeiter – die zurzeit alle kurzarbeiten – sowie normalerweise 30 Minijobber, und ist „als Premium-Fitnesscenter konzipiert mit Spezialisierung auf Rücken und Gelenke“, wie Jäger erklärt. Dafür bietet das Rückgrat ein selbst entwickeltes Trainingskonzept an. Dieses und das sehr gutes Wirtschaften in der Vergangenheit sieht der Studioleiter als Gründe, warum das Rückgrat „noch relativ gut dasteht“. Gleichwohl brach der Umsatz zwischen März 2020 und Februar 2021 um 42,9 Prozent ein. Vom 17. März bis zum 2. Juni war und seit dem 2. November ist das Fitnessstudio wieder geschlossen. Zwischen den zwei Lockdowns war der Zuspruch der Kunden groß – und der Umsatz entsprach dem des Vorjahreszeitraums. Dies sowie die verschiedenen Hilfen einschließlich des Kurzarbeitergelds konnten die Verluste aber bei Weitem nicht auffangen, sagt Jäger. „Hätten wir gewusst, dass wir innerhalb eines Jahres sechs Monate schließen müssen, hätten wir wirtschaftlich ganz anders agiert.“ Den Frühjahrslockdown vor einem Jahr nutzte das Rückgrat, um neue, miteinander vernetzte Geräte anzuschaffen und ein günstiges Liquiditätsdarlehen aufzunehmen. Hätten Inhaber Lutz Kruger und Finanzchefin Sigrid Speck gewusst, dass ein zweiter, längerer Lockdown folge, hätten sie die dreifache Menge beantragt, berichtet Jäger. „Jetzt stehen wir aus Sicht der Banken natürlich nicht mehr so gut da wie noch vor einem Jahr.“ Ein weiteres Problem: Da die Fitnessstudios geschlossen sind, können sie zurzeit keine neuen Mitglieder akquirieren, um die übliche Fluktuation der Kunden aufzufangen. Den bestehenden bieten Frank Jäger und sein Team dafür über einen Youtube-Kanal verschiedene Trainings an. „Das ist wichtig zur Mitgliederbindung“, sagt er.

Kinos
„Wir freuen uns, wenn wir wieder öffnen können und hoffen, dass es wieder angenommen wird“, sagt Christel Kauschwitz, die zusammen mit ihrem Mann Lothar und zwei Minijobbern die Löwen-Lichtspiele in Kenzingen betreibt. Sie verfügen über einen Saal mit 174 sowie ein Studio mit 29 Plätzen und sind ein für den ländlichen Raum typisches kleines Kino, das sich schon vor Corona in einer Nische behaupten musste – und dies auch machte. Bis die Lichtspiele Mitte März 2020 plötzlich schließen mussten. „Das war natürlich richtig, aber es war ein Schock. Das gab es noch nie“, erinnert sich Christel Kauschwitz, die das von ihren Eltern nach dem Krieg wiederaufgebaute Haus seit über 50 Jahren betreibt. Sie und ihr Mann sind längst im Rentenalter, doch am Kino hängt ihr Herzblut. Solange sie die Unkosten – Heizung, Strom und vor allem die Leihgebühr für die Filme – wieder einspielen, machen sie weiter. Das haben sie sich vorgenommen. Ob das 2020 gelungen ist, weiß Christel Kauschwitz noch nicht. Der Umsatz ist vergangenes Jahr um 68 Prozent eingebrochen. Von Mitte Juli bis Ende Oktober kamen trotz des Hygienekonzepts mit seinen Abstandsregeln nur sehr wenige Gäste – zu wenige, um die Kosten zu refinanzieren. Die, die kamen, halfen dem Ehepaar hingegen beim Desinfizieren und sprachen ihm Mut zu. Über die staatlichen Hilfen ist die Kinobetreiberin dankbar. Ihr Appell an die Politik: „Wir brauchen Planungssicherheit. Nur so bleibt die Kinokultur im ländlichen Raum erhalten.“

Reisebüros
Reisebüros gehören ebenfalls zu den besonders betroffenen Branchen in der Krise. Waren sie vergangenes Frühjahr vor allem mit Rückabwicklungen und Stornierungen beschäftigt, hatten Arbeit, hohe Kosten und mussten bereits verdientes Geld zurückerstatten, machen ihnen jetzt die unsicheren Aussichten zu schaffen. Der Deutsche Reiseverband (DRV) rechnet erst mit verstärkten Buchungen, wenn es Lockerungen gibt und pocht daher auf weitere staatliche Hilfen sowie schnelle Impfungen. Viele der Reisebüros, besonders kleine, kommen dank Erspartem, Kurzarbeit und staatlichen Hilfen zumindest bislang einigermaßen über die Runden. Allerdings rechnen deutschlandweit rund drei Viertel der Reisebüros und -veranstalter für 2020 mit einem Umsatzrückgang von 80 bis 90 Prozent. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Reiseverbands (DRV) hervor, die Anfang Dezember veröffentlicht wurde. Rund 90 Prozent von ihnen sehen sich demnach in ihrer Existenz bedroht.
Das größte inhabergeführte Unternehmen der Branche in der Region, das Reisebüro Bühler mit Hauptsitz in Schramberg, 37 Büros und 220 Mitarbeitern, musste Ende November Insolvenz anmelden. Grund waren die zu hohen Fixkosten. Laut Ingo Schorlemmer, Pressesprecher der Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH mit Sitz in Achern, ist das Reisebüro Bühler bei den Coronahilfen durchs Raster gefallen – zu klein und unbekannt, um wie Lufthansa oder Tui vom Staat gerettet zu werden, und zu groß, um mit den vergleichsweise geringen Hilfen von maximal 50.000 Euro überleben zu können. Ein „Webfehler“ bei den Hilfen, so Schorlemmer. Das Problem sei gewesen, dass die verschiedenen stationären Reisebüros nicht als einzelne Firmen geführt wurden. Wäre dies so gewesen, hätte das gesamte Unternehmen ein Vielfaches der staatlichen Hilfen erhalten. Allerdings wurden zwei externe Investoren gefunden: Contravo aus Berlin hat den Bereich Geschäftsreisen inklusive der sechs zugehörigen Büros übernommen, die AER Travel Holding, ebenfalls mit Sitz in Berlin, 14 der stationären Reisebüros. Rund zwei Drittel der Mitarbeiter waren Ende Januar übernommen worden oder bei anderen Betrieben der Branche untergekommen, darunter alle 42 Azubis.

Staatliche Hilfen
Dass manche Unternehmen wie das Reisebüro Bühler bei den staatlichen Überbrückungshilfen durchs Raster fallen, ist ein Problem. Ein anderes, dass sich deren Auszahlung zum Teil zwei bis drei Monate hinzieht und den betroffenen Unternehmen somit dringend benötigte Liquidität fehlt. Die Einzelhändler und andere Unternehmer, die Mitte Dezember ihre Geschäfte schließen mussten, konnten die für sie erweiterte Überbrückungshilfe III erst ab 10. Februar beantragen. Die Rechtsunsicherheit aufgrund neuer EU-Regeln kommt erschwerend hinzu: Lange gab es Befürchtungen, dass ein Teil der bereits bewilligten Überbrückungshilfe II zurückgezahlt werden muss. Diese Sorgen sind nun für fast alle Unternehmen ausgeräumt. Davon berichtet Martin Rau, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei der Loeba Treuhand GmbH in Lörrach, einer auf Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung spezialisierten Kanzlei mit 65 Mitarbeitern.
Die Kritik an der schleppenden Auszahlung der November- und Dezemberhilfen für die Hotellerie und Gastronomie sowie die Veranstaltungs- und Freizeitbranche, die ab November schließen mussten, kann er indes nicht nachvollziehen. Ein bis zwei Tage nach Antragstellung sei an die Mandanten seiner Kanzlei ein Abschlag von 50 Prozent gezahlt worden. „Es ist aber zum Teil eine Enttäuschung da, weil die unterschiedlichen Hilfen miteinander verrechnet werden“, sagt Rau. Wer Novemberhilfe beantragt hat, aber auch Kurzarbeitergeld bezieht und Überbrückungshilfe erhalten hat, bekomme bei Weitem nicht die maximal möglichen 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat. Rau begrüßt es daher, dass gerade für kleine Unternehmen – das sind neben Soloselbstständigen auch viele Gastronomen – in Baden-Württemberg im Rahmen der Überbrückungshilfe I und II ein Unternehmerlohn von maximal 1.180 Euro im Monat eingeführt wurde, der nicht auf die Monatshilfen angerechnet wird. Konnten die Unternehmen die Soforthilfen im vergangenen Frühjahr noch selbst beantragen, sind dafür nun angesichts von Betrugsfällen die Steuerberater zuständig. „Das ist für uns ein erheblicher Mehraufwand in einer Zeit, in der wir angesichts der Jahresabschlüsse voll ausgelastet sind“, sagt Rau. Finanziell lohnen würde sich das Zusatzgeschäft nicht, es sei eher Service für die Mandanten.
Hilfsprogramme
Alle Hilfsprogramme im Überblick:
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
Infos zu den Überbrückungs- und Monatshilfen:
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
Details zum Tilgungszuschuss Corona für Schausteller und die Eventbranche gibt es unter
wm.baden-wuerttemberg.de, Rubriken Service, Förderprogramme
Mehr zum KfW-Schnellkredit ist zu lesen unter
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/KfW-Corona-Hilfe/
Insolvenzen
Weil die staatlichen Coronahilfen so schleppend ausgezahlt werden, ist derzeit die Insolvenzpflicht für alle Unternehmen, die Anspruch auf diese Hilfen haben, ausgesetzt (Stand bei Redaktionsschluss: bis Ende April). Aber was kommt danach? „Es ist schon davon auszugehen, dass die Coronapandemie eine Bremsspur hinterlassen wird“, sagt Ingo Schorlemmer von Schultze & Braun mit Blick auf künftige Insolvenzen. „Aber ob es ein Tsunami wird oder sich über einen längeren Zeitraum zieht, lässt sich jetzt noch nicht sagen.“ Er rechnet damit, dass vor allem bestimmte Teile der Wirtschaft betroffen sein werden – zum Beispiel Hotels, die auf Dienstreisende und Tagungen spezialisiert sind, die Veranstaltungsbranche vom Messebauer bis zum Technikdienstleister sowie die Reisebranche und alle, die von ihr abhängen bis hin zum Flugzeugbauer und deren Zulieferern oder Dienstleistern. Alles hängt seiner Ansicht nach davon ab, wie gut die verschiedenen staatlichen Maßnahmen wirken. Das sind neben den Coronahilfen das Kurzarbeitergeld und das zum Jahresbeginn in Kraft getretene neue Insolvenzrecht (Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, Starug), das helfen soll, angeschlagene Unternehmen auch ohne Insolvenzverfahren zu sanieren. All das kann dazu führen, „dass die Insolvenzwelle abgemildert wird“, so Schorlemmer.

Wirtschaftliche Entwicklung
„Wenn man die Wirtschaft differenziert betrachtet, dann kann man klar sagen, dass wir im vergangenen Jahr noch relativ glimpflich davongekommen sind“, sagte Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg, Leiter des dortigen Walter Eucken Instituts und bis Ende Februar Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (ob er für eine weitere Amtszeit berufen wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest), im Januar-Podcast der IHK-Südlicher Oberrhein. „Schrille Töne“ höre man natürlich von denen, die besonders stark betroffen sind. „Wer nicht klappert, der kann auch nicht erwarten, dass die Politik ihm irgendetwas gibt“, ordnete Feld dies ein. Bereits im März vergangenen Jahres hatte der Sachverständigenrat in einem Sondergutachten ein Schrumpfen der Wirtschaft im Jahr 2020 um 5,4 Prozent vorausgesagt – eine realistische Einschätzung, wie sich laut Feld gezeigt hat. Für 2021 prognostizierten die Wirtschaftsexperten vergangenen Herbst noch ein Wachstum von 3,7 Prozent – trotz Restriktionen im Winterhalbjahr. So starke Verschärfungen, wie sie dann ab Dezember beschlossen wurden, hatten die Experten damals allerdings nicht erwartet. Deshalb korrigierte Feld seine Prognose im Januar etwas nach unten, betonte aber: „Es ist immer noch eine 3 vor dem Komma möglich.“
Susanne Maerz
Der Tourismus im Land 2020
Zehn Jahre lang jagte im Tourismus ein Rekord den nächsten, 2020 folgte ein krasser Einbruch: Die Zahl der Gäste ging in Baden-Württemberg vergangenes Jahr coronabedingt um 48,9 Prozent und damit auf 11,9 Millionen zurück. Die Zahl der Übernachtungen sank um 40,2 Prozent auf 34,2 Millionen. Die schlechtesten Monate waren April, Mai und Dezember. Im Sommer boomte es unter anderem am Bodensee. Der Hegau und die Bodenseeregion verbuchten denn auch die geringsten Rückgänge mit 16,1 beziehungsweise 23,8 Prozent weniger Übernachtungen als 2019. Unter den Städten belegte Freiburg wie schon 2019 nach Stuttgart den zweiten Platz – allerdings mit 1,1 Millionen Übernachtungen statt 1,8 Millionen wie 2019. Fern blieben im ganzen Land vor allem Gäste aus dem Ausland, Geschäftsreisende, aber auch Schulklassen und andere Gruppen. Jugendherbergen, Ferien- oder Schulungsheime mussten Rückgänge von knapp 50 bis etwa 70 Prozent hinnehmen. Die Hotellerie, auf die die meisten Übernachtungen entfallen, verbuchte einen Rückgang von landesweit 45,6 Prozent. Am wenigsten schlecht lief es für Campingplätze (minus 16,5 Prozent) sowie Ferienwohnungen, -häuser und -zentren (minus 19,7 Prozent). All diese Zahlen veröffentlichte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg Mitte Februar. Berücksichtigt wurden dafür 6.200 Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten oder Stellplätzen. mae
